Das südlich von Nürnberg gelegene Georgensgmünd ist eine Gemeinde im Landkreis Roth (Mittelfranken, Bayern). Seit dem 16. Jahrhundert war Georgensgmünd, an wichtiger Handelsstraße gelegen, auch die Heimat sogenannter Schutzjuden, ein Dorf typischen Landjudentums. Vom Ausgang des Mittelalters bis ins 18. Jahrhundert standen hier Juden unter dem Schutz herrschender Fürsten, die ihnen die Sicherheit von Person, Eigentum und Religion garantierten. Sie gewährten Juden gegen die Zahlung eines jährlichen Schutzgeldes und weiterer Abgaben zu bestimmten Anlässen mit sogenannten “Schutzbriefen” ein zeitlich befristetes Niederlassungsrecht, teilweise mit Handelslizenz. Schutzjuden wurden somit zu einer wichtigen Einnahmequelle. Fast 400 Jahre lang, etwa von 1560 bis 1938, lebten Juden in Georgensgmünd, sie stellten zeitweise ein Drittel der Bevölkerung. Mit der Synagoge (von 1733 bis 1735 errichtet), zwei Ritualbädern (Mikwen) und einem großen Friedhof mit Totenwaschhaus (Taharahaus) ist in Georgensgmünd ein typisches Ensemble einstigen jüdischen Lebens im ländlichen Raum vollständig erhalten geblieben. Die Synagoge wurde umfassend restauriert und erinnert heute mit einer Ausstellung an die Landjuden im Kreis Roth. Der jüdische Friedhof wurde um 1580 angelegt, etwa 1800 Grabsteine sind heute noch erhalten, 1946 wurde ein Schwabacher KZ-Überlebender als letzter Jude beerdigt auf dem Friedhof beerdigt. Das renovierte Taharahaus stammt von 1723 und gehört zu den ältesten in Bayern.
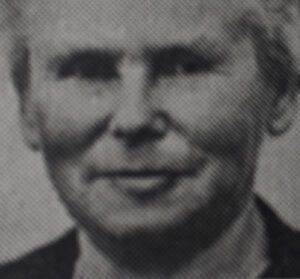 Martha Neumark wurde am 19.2.1872 in Georgensgmünd geboren. Die Neumark-Familie in Georgensgmünd war groß und einflussreich. Marthas Elternhaus stand in der Rittersbacher Straße 3, ihr Vater Emanuel Neumark war von Beruf Metzger, ihre Mutter Klara eine geborene Gutmann. Martha kam als viertes von sechs Kindern zur Welt.
Martha Neumark wurde am 19.2.1872 in Georgensgmünd geboren. Die Neumark-Familie in Georgensgmünd war groß und einflussreich. Marthas Elternhaus stand in der Rittersbacher Straße 3, ihr Vater Emanuel Neumark war von Beruf Metzger, ihre Mutter Klara eine geborene Gutmann. Martha kam als viertes von sechs Kindern zur Welt.
Als sie 23 Jahre alt war, heiratete sie 1895 den am 20.1.1863 in Georgensgmünd geborenen Jakob Neumark, einen ihrer entfernten Vettern. Jakobs Großvater, der Schnittwarenhändler Abraham Neumark und Marthas Großvater, Samuel Hirsch, Ökonom und Viehhändler, waren Brüder. Jakob war ein erfolgreicher Kaufmann, er handelte mit Immobilien, Getreide und Hopfen und war lange Gemeindevorsteher und Mitglied im Gemeinderat. Martha zog nach ihrer Hochzeit zu ihrem Mann in dessen Elternhaus (Am Anger 11). Jacobs Urgroßvater Josef Immanuel Neumark hatte dieses Haus 1788 gekauft, nach dem Tod seines Vaters gehörte es ihm. Bis 1898 wohnten die Neumarks dort, hier wurden ihre Kinder geboren (Irma am 26.2.1897, Otto am 30.8.1898). Nachdem das Haus mehr als 100 Jahre im Besitz der Familie gewesen war, verkaufte es Jacob 1906 und zog mit Martha und den Kindern in die Pleinfelder Straße 6 (früher Bahnhofstraße 54).
1918 verließ Martha und Jakobs Sohn Otto im Alter von 20 Jahren die Familie und zog nach Nürnberg. Ihre Tochter Irma heiratete 1920 Siegfried Dreyfuß und zog zu ihm nach Heilbronn. Dort kamen Marthas Enkeltöchter Ruth (am 19.3.1921) und Hannelore (am 16.2.1926) zur Welt. Die Geburt der zweiten Enkeltochter hat Marthas Mann Jakob nicht mehr erlebt: er starb im Alter von 52 Jahren am 13. April 1925.
So blieb Martha Neumark allein in Georgensgmünd zurück.
Wie überall nahm der Boykott gegen Juden auch in Georgensgmünd nicht erst seit der Machtübernahme Hitlers zu. Schon 1924 hetzte der „Stürmer“ gegen den „judenverseuchten Markt Georgensgmünd“. Martha sah sich gezwungen, 1929 ihr Haus verkaufen, konnte aber zunächst noch weiterhin zur Miete dort wohnen bleiben. Zu dieser Zeit waren in Georgensgmünd noch 49 Juden gemeldet.
Martha Neumark in Heilbronn und Stuttgart von 1934-1940
Entwurzelung, Entrechtung und totale Ausgrenzung
1935 trug eine Tafel am Ortseingang von Georgensgmünd den Satz: „Unser Bedarf an Juden ist hinreichend gedeckt“. Im Mai 1938 wohnten noch 13 jüdische Bürger in Georgensgmünd, Ende 1938 keiner mehr.
So verließ auch Martha Neumark 1934 nach Bedrohungen und Misshandlungen jüdischer Bürger in Georgensgmünd ihre Heimat – die Heimat ihrer Familie seit Generationen. 62 Jahre alt und seit 9 Jahren Witwe, suchte sie Schutz bei ihrer Tochter Irma in Heilbronn. Irmas Mann Siegfried Dreyfuss war dort Inhaber der Firma „Dreyfuß und Söhne. Schrott-und Metallwerke Öhringen, Heilbronn, Mannheim und Reutlingen“. Im gleichen Jahr – 1934 – wurde die Firma von Siegfried Dreyfuß arisiert (heute Remondis). Nach dieser Demütigung schien für Irma und Siegfried weiteres Leben in Heilbronn unerträglich, sie fühlten sich bedroht und dachten, in der Anonymität einer Großstadt ein von der Politik unbehelligtes Dasein führen zu können. 1937 zogen sie, zusammen mit ihrer Mutter Martha und den Töchtern Ruth (16 Jahre alt() und Hannelore (11 Jahre alt) nach Stuttgart in die Seestraße 112. Dort hatte ein jüdischer Hausbesitzer in der Seestraße 112 und 114 mehrere Wohnungen an jüdische Mieter vermietet: an Lucie und Kornelia Meyer, an Moritz und Irma Rosenthal, an Gertrud Lazarus, an Julie Hammel und an Eva und Käthe Stettiner.
Aber auch hier in Stuttgart wussten sich die Irma und Siegfried Dreyfuß mit ihren Kindern zu Recht nicht sicher. Sie flohen zwei Jahre später schon, am 19.5.1939, nach Straßburg und von dort nach Kriegsausbruch unter Verlust ihres Hausstandes nach Lyon.
Martha Neumark blieb ein zweites Mal allein zurück.
1940-1943: Zwangsumsiedelung – Ghetto – Ermordung
Im Griff des NS-Staats
Nachdem ihre Kinder geflohen waren, musste Martha Neumark 1940 (sie war jetzt 68 Jahre alt), von der Seestraße aus in den Stuttgarter Westen, in die Gutbrodstraße 89 ziehen. Von hier aus wurde sie ein Jahr später am 19.9.1941 – zusammen mit weiteren 57 überwiegend älteren Personen aus Stuttgart und anderen württembergischen Gemeinden – ins Schloss Weißenstein der Grafen von Rechberg umgesiedelt, ein in der NS-Zeit als jüdisches Altersheim getarntes Durchgangslager.
Martha Neumarks Sohn Otto, 1937 nach New York emigriert, hatte zwar noch versucht, für seine Mutter ein Visum für Kuba zu beschaffen. Aber nach der Kriegserklärung der Hitlerregierung an die U.S.A. am 11.12.1941 war dies nutzlos geworden.
Im August 1942 wurden die jüdischen „Altersheime“ aufgelöst. Martha Neumark wurde zusammen mit den letzten ca. 26 jüdischen Mitbewohnern von Weißenstein aus zurück nach Stuttgart transportiert. Nach vier langen Tagen im kurzfristig eingeräumten Sammellager für die Osttransporte in der Blumenhalle des Killesbergparks begann am 22./23.August 1942 vom Nordbahnhof Stuttgart aus der Transport in den Tod.
Martha Neumark kam (zusammen mit Moritz und Irma Rosenthal, Julie Hammel und Gertrud Lazarus aus der Seestr.112/114) mit dem Transport XIII/1 ins Übergangslager Theresienstadt. Dort ist sie, 71 Jahre alt, am 9.4.1943 gestorben – ermordet durch Krankheit und Hunger und ihrer Menschenwürde beraubt.
Ihre Tochter Irma wurde zusammen mit ihrem Mann Siegfried Deyfuß am 30.8.1943 in Lyon verhaftet, in das Sammellager Drancy transportiert und von dort aus am 12.10.1943 nach Auschwitz gebracht.
Ihre Enkelkinder Ruth und Hannelore sind durch französische Hilfsorganisationen gerettet worden. Ruth Dreyfuß, verh. Wolf, lebte nach dem Krieg in Lyon, Hannelore Dreyfuß, verh. Wertheimer, in Neuillys-sur-Seine.
Marthas Sohn Otto Neumark, schon 1936 mit Frau Frieda und Tochter Suse in die USA emigriert, starb dort 1970.
_______________________________________________________________
Recherche und Text: Ute Ghosh, Stolperstein-Initiative Stuttgart-Nord
Quellen: Staatsarchiv Ludwigsburg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Stadtarchiv Stuttgart, Stadtarchiv Reutlingen
Gerd Berghofer: Das jüdische Georgensgmünd. Häuser. Familien. Kurzbiografien. Literatones 2020




